Das folgende Interview ist im Jahre 2011 in der testcard #21 erschienen. Jene Ausgabe der Anthologie linken Popdiskurses hatte den Themenschwerpunkt „Überleben – Pop und Antipop in Zeiten des Weniger“. Das Interview soll hier noch einmal abgedruckt werden. Es dokumentiert, wie Therapieerfolge dank effektiver antiretroviraler Kombitherapie, das damals gerade erschienene EKAF-Statement und sich daraus ergebende Chancen der Normalisierung von Aids diskutiert wurden. Das noch ohne den Begriff „undetectable“, der heute gang und gäbe ist. Und das lange vor Aufkommen der PrEP.
Dorothée Krings
LONGTIME COMPANION
Übers Leben mit HIV. Ein Gespräch mit Falk Springer und Stefan Müller
1996. Die aktuelle Benetton-Werbung mit HIV-POSITIV-Stempeln auf nackten Ärschen. Ich bügle Armani- und Hugo-Boss-Hemden. Und noch schnell ängstlich mit dem Staubtuch um die Fix-Bestecke großräumig herumgewischt. Mein großes Ohr widmet sich Stunden über Stunden dem Zuhören. Klient_innen hatten ihren Grabschmuck bereits ausgesucht. Mit der neuen Dreier-Kombinationstherapie bestellen sie ihn wieder ab. Sie müssen nun plötzlich vom Sterben ins Wieder-Weiterleben-Jetzt! umzuschalten. Einer umarmt mich mit pockenartigen Ausstülpungen im Gesicht zur ersten Begrüßung. Ich schäme mich noch lange für meine Gefühle des Ekels. Er stirbt als erster während meiner Zeit bei der Aids-Hilfe. – Einige meiner Bilder des alten Aids.
2010. Betreuung HIV-positiver Männer. Meine Arbeit besteht jetzt darin, Hartz-4-Löcher durch Stiftungsanträge zu stopfen. Nebenbei muss ich die Auswirkungen durchgekokster Wochenenden in Dämmmaterial packen. Blutwerte sind noch Thema, aber an den Folgen von Aids zu sterben ganz selten. Das sind wohl Gesichter des neuen Aids.
Neues Aids als Begriff soll die Entwicklung bzw. den Gegensatz zum alten verdeutlichen. Zunächst einmal muss die Krankheit nicht mehr zwansgläufig ausbrechen. Mit HIV lebt man heute länger, es gibt Möglichkeiten der Behandelbarkeit. Nach Martin Dannecker, einem Berliner Sexualwissenschaftler, „… haben die gesellschaftlichen Verhältnisse in den westlichen Industrieländern im Verein mit der medizinischen Kunst zu einer Situation geführt, die es ermöglicht, dass wir uns individuell und kollektiv von Aids verabschieden können.“ Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen steht eine Normalisierung ins Haus, die einen Prozess der Entstigmatisierung mit einschließen wird. Zugleich ist aber deutlich zu bemerken, wie schwer es fällt, von den oben erwähnten alten Bildern loszulassen.
Was als neue Aufgabe von Prävention bezeichnet werden muss, nämlich dieses neue [und komplexere] Bild positiv zu vermitteln und gleichzeitig weiterhin zu individuellem [und komplexeren] Schutzverhalten zu motivieren, ist zugleich ihre Krise. Die Aufklärung schafft sich ab und ist zugleich weiter notwendig.
Um mehr Beton in das Fundament der Normalisierung zu gießen, führte ich das folgende Gespräch im Sommer diesen Jahres mit zwei Freunden, die sich vor unserem Treffen nicht kannten.
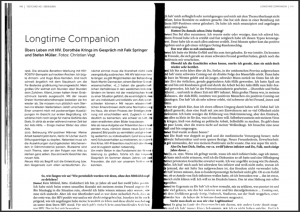
Dorothée: So, wie fangen wir an? Wie persönlich werden wir denn, ohne den Mitleidsknopf zu drücken?
Stefan: Kein Mitleid, bitte. (Gekicher) Ich bin 32 Jahre alt und fast zwölf Jahre positiv. Ich habe mich beim ersten sexuellen Kontakt mit meinem ersten Freund angesteckt. Bin blauäugig in die Situation rein, obwohl ich hätte wissen müssen oder wusste, wie man sich ansteckt. Aber ich war überfordert und es war dann sicherlich Pech, dass es der erste war, der HIV-positiv war und es mir direkt mitgegeben hat. Insofern ist für mich prägend, wie ich angefangen habe meine Sexualität zu leben und diese direkt von Anfang an unter dem Stern HIV stand. Für mich gab´s einfach kein ausschweifendes Sexleben vor HIV. Das ist bei mir besonders.
Ich hab mich anfänglich sehr zurückgezogen und mich mit dem Thema überhaupt nicht befasst, keine Kontakte zu anderen gesucht. Das hat sich dann in einer Beziehung mit einem HIV-Positiven etwas gelockert. Da habe ich mich emanzipiert und angefangen damit umzugehen.
Dorothée: Hattest du damals schon dein Outing?
Stefan: Das fiel alles zusammen. Ich wusste mehr oder weniger, dass ich schwul bin. Einem Freund habe ich es erzählt und fast zeitgleich habe ich diesen Typen kennen gelernt. Dann habe ich es auch allen anderen erzählt. Zwei Monate später kam das positive Ergebnis und es gab einen richtigen Outing-Rundumschlag.
Dorothée: Das war alles so nah aneinander.
Stefan: Ich hatte ein blödes Gefühl und bin zum Arzt gelaufen. Es war intuitiv. Da konnten die Freunde, die sich gerade an einen schwulen Freund gewöhnt haben, gleich noch das Positivsein mit verarbeiten.
Dorothée: Obwohl ich die Geschichte schon kenne, merke ich gerade, dass sie mich doch wieder sehr berührt.
Falk: Ich bin sechs Jahre älter als du, Stefan, in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen und hab mein schwules Coming Out als direkte Folge des Mauerfalls erlebt. Dann habe ich kurz im Westen gelebt und als junger schwuler Mann zurück im Osten bin ich der erste Zivi der örtlichen, gerade gegründeten Aids-Hilfe geworden. Ich hatte Spaß am Sex und bin mit Kondomen groß und durch die Arbeit bei der Aids-Hilfe zum Safer-Sex-Kind geworden. Ich hab‘ in der Präventionsindustrie gearbeitet … (Dorothée und Stefan kichern) … und mich in dieser Zeit mit HIV infiziert. Mein großes Thema war, in meinem „Zuhause“, der Aids-Hilfe, inmitten von positiven Menschen ein positives Coming Out hinzulegen. Das hab ich als sehr schwer erlebt, viel schwerer als bei Freund_innen und Eltern.
Es war mir gleich klar, dass ich einen offenen Umgang damit haben will. Dabei hab ich schnell gemerkt, dass eine Stadt mit 200.000 Einwohnern mit so viel Offenheit nicht klarkommt. Ich hatte weniger die Erfahrung von Diskriminierung, aber den Eindruck, dass alles zu klein ist für das, was ich machen will. Selbstbewusstsein mit meinem Virus zu kriegen, hieß von Anfang an politische Arbeit, Selbsthilfe zu machen. Da gab´s dann ein paar Leute, aber die waren nicht auf meiner Wellenlänge. Ich brauchte eine neue Stadt und bin umgezogen.
Stefan: Und wurde es dann besser?
Falk: Die Stadt war doppelt so groß und die medizinische Versorgung besser; mehr schwule Infrastruktur und erste queere Bezüge. Neuer Freundeskreis, Erwerbsarbeit: Es gab niemanden, der von meinem Positivsein nicht wusste. Das war super für mich.
Dorothée: Also du hast dich, Stefan, vor ca. zwölf Jahren infiziert und du, Falk, noch einige Jahre davor …
Falk: Ja. Ca. 1992. Wenn ich gefragt werde, wann ich mich infiziert habe, sage ich immer, ich kann mich nicht erinnern, weil ich die Diskussion so oft hatte und eine Offenlegung meiner privatesten Geschichte erwartet wurde. Ich war ungefähr so jung wie du damals, Stefan. Ich hab‘ mich auch bei schwulem Sex infiziert und weiß nicht mehr, warum ich als jemand, der mit Safer Sex aufgewachsen ist, das Kondom nicht verwendet habe. Ich hab‘ lernen müssen, dass es 100% Sicherheit nicht gibt. Ob es ein Unfall war, ob es Anteile von Sich-infizieren-wollen hatte, ob ich betrunken war … das ist etwas, was ich nicht klären will. Ich will es im Dunkeln lassen. Das ist eine Haltung mir selbst gegenüber.
Stefan: Im Gegensatz zu dir hab‘ ich schon versucht, mir zu erklären, was passiert ist und habe viel gelesen, wie das bei anderen war und bin darauf gekommen … Coming Out, mit dem Zivildienst gerade fertig, Umbruch, Studieren, aus der Stadt weggehen, erster schwuler Sex – da haben die Schutzmechanismen ausgesetzt.
Dorothée: Sucht man doch sowas wie eine Legitimation?
Stefan: Es ging im Laufe des Prozesses bei mir darum, wie andere Leute damit umgehen und ich hab‘ immer klarer bekommen, wie ich es nicht haben möchte. Und ich habe Erklärungsversuche gesucht und geguckt, wie sehr sie auf mich zutreffen oder eben nicht. Wie gesagt, es geht nicht um Legitimation, sondern warum, was, wie gekommen ist.
Falk: Bei mir ging es um die Vermeidung einer Schuldfrage: Das ist passiert und ich möchte das als Faktum in mein Leben aufnehmen. Ich eck‘ halt immer wieder an, weil es diesen Druck gibt, sich zu offenbaren.
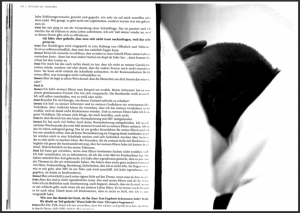
Dorothée: Ich hätte eher gedacht, dass man sich nicht traut nachzufragen, weil das sehr privat ist.
Falk: Das Nachfragen wird eingepackt in eine Haltung von Offenheit und Toleranz. Es ist so selbstverständlich, dass man das natürlich fragen kann.
Stefan: Wenn ich versuche zu erklären, dass es jeden in einer Scheiß-Phase seines Lebens erwischen kann – dann hat man andere Sachen im Kopf als Safer Sex -, dann kommt das schon bei den Leuten an.
Falk: Für mich hat das auch nichts damit zu tun, dass ich nicht zu meiner Geschichte stehen würde, sondern viel eher damit, dass die andere Person mich nicht einordnen kann. Sie kann nicht einfach die Schublade aufmachen. In der Kommunikation bleibt etwas offen, was sozusagen nicht verhandelbar ist.
Stefan: Aber du legst ja schon Wert darauf, dass die Menschen um dich herum das wissen, oder?
Falk: Ja.
Stefan: Ich hab´s meinen Eltern zum Beispiel nie erzählt. Meine Schwester hat es von einem gemeinsamen Freund. Der hat sich verquatscht. Die Restfamilie weiß es nicht. Ich will selber entscheiden, wer es weiß oder nicht.
Falk: Brauchst du viel Energie, um diesen Zustand aufrecht zu erhalten?
Stefan: Ich hab‘ zu meiner Schwester und zu meinen Großeltern ein vertrauensvolles Verhältnis. Aber vielleicht könnt ihr verstehen, dass ich das meinen Großeltern nicht erzähle, weil sie damit nicht klar kommen würden. Und zu meinen Eltern habe ich kein gutes Verhältnis. Die wissen viele Dinge, die mich betreffen, auch nicht.
Falk: In dem Bereich hat also keine Normalisierung mit HIV stattgefunden.
Stefan: Da hat auch viel früher noch keine Normalisierung stattgefunden. Ich werde nächstes Wochenende das erste mal meinen Freund mit zu meinen Eltern nehmen. Allein das ist schon aufregend genug. Das ist ein großer Stressfaktor für meine Eltern und ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Normalisierung im Umgang damit stattfinden würde. Sie würden mich in eine Schublade stecken und sich Gedanken machen über Sachen, die es sich nicht zu machen lohnt. Bei Freunden, die da erstmal nicht mit klar kommen, begleite ich gerne die Auseinandersetzung, aber bei meinen Eltern habe ich keinen Bock drauf. Wahrscheinlich ist das meine Tabuzone.
Falk: Ich kann gut verstehen, wenn man Eltern bestimmte Sachen nicht erzählen will. Ich hab entschieden, sie zu informieren, als ich das erste Mal im Krankenhaus lag. Die haben natürlich ihre Zeit gebraucht. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es nur eins der Themen ist, die wir miteinander haben. Die haben eben einen ganz anderen Entwurf von Haus, Festanstellung, Beziehung, Sicherheiten, den ich so nicht lebe. Sie fragen zwar, wie es mir geht, aber HIV ist ein Tabu und wird umschifft. Ich habe irgendwann aufgegeben, sie damit zu konfrontieren. .
Stefan: Man entwickelt ja auch seine eigene Sicht auf das Thema, wenn man da drin steckt.
Falk: Aber das sind ja nicht irgendwelche Leute. Das sind meine Eltern und als ihr Sohn habe ich ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Support, danach dass sie da sind, wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich ein anderes Leben führe. Es ist immer noch da und es ist auch ok. Damit muss ich klarkommen, dass es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.
Dorothée: Wie war das damals bei euch, als ihr euer Test-Ergebnis bekommen habt? Habt ihr direkt an Tod gedacht? Wann habt ihr eure Therapien begonnen?
Stefan: Bei dir, Falk, kann ich mir vorstellen, dass du relativ cool geblieben bist, weil du ja durch deine Aids-Hilfe-Arbeit alles wusstest.
Falk: Nee, das war überhaupt nicht cool. Es ist in meinem direkten Umfeld nicht jeden Monat jemand gestorben, aber dadurch, dass ich viel rumgekommen bin, Freund_innen in anderen Städten hatte und oft in Berlin war, musste ich mich als junger Mann damit auseinandersetzen, dass gestorben wird. Und zwar häufig, was für mich schwer war. In dem Alter, in dem alles losgeht, alles wegbricht. Ich hab mich weniger mit meiner Krankheit auseinandergesetzt, sondern vor allem Aktionismus und Prävention gemacht. Bin nach vorne geflohen. Ich hab mich gegen einen frühen Therapiebeginn entschieden und bin im Nachhinein damit gut gefahren. Aber es sind ein paar Jahre vergangen, bis ich öfters krank war. Für mich war es wichtig, selbst zu entscheiden, wann ich mit der Therapie anfange und dann war´s auch richtig so. Es gab durchaus Therapie-Druck. Medial, auf Kongressen sowie durch medizinische Studien – da herrschte viel normativer Druck, ein guter Positiver zu sein und das Angebot auch mitzumachen. Entweder ich war der schon oder wollte nie einer werden.
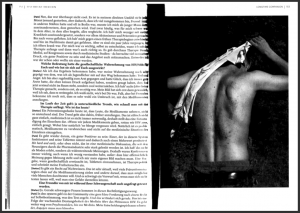
Dorothée: Welche Bedeutung hatte die gesellschaftliche Wahrnehmung von HIV/Aids für euch und wie hat sie sich auf euch ausgewirkt?
Stefan: Als ich das Ergebnis bekommen habe, war meine Wahrnehmung noch sehr geprägt von dem, was ich als Jugendlicher mit auf den Weg bekommen habe: Tod und Angst. Ich bin aber regelmäßig zum Arzt gegangen und hatte Glück, dass ich immer gute Ärzte hatte, die eben keinen Druck aufgebaut haben, sondern gesagt haben, dass Tod jetzt erstmal nicht im Raum steht, sondern cool weiterzuleben. Ich hab‘ sechs Jahre keine Therapie gemacht, sondern erst, als es nötig war. Mein Bild hat sich erst dann gewandelt, weil ich sah, dass es weitergeht. Ich weiß nicht, wie´s bei dir war, Falk, aber bei Freunden bekomme ich noch mit, dass es sehr wohl ein Umbruch ist, mit den Medikamenten anzufangen.
Dorothée: Im Laufe der Zeit gab´s ja unterschiedliche Trends, wie schnell man mit der Therapie anfängt. Wie ist das heute?
Stefan: Ein Präventionsgedanke heute ist, dass Leute, die Medikamente nehmen, nicht so ansteckend sind. Der Trend geht also dahin, früher anzufangen. Das ist ethisch nicht ganz einfach, medizinisch ist es nicht immer notwendig, deshalb stellt das eine Entmündigung des Einzelnen dar. „Wenn wir jedem Medikamente geben, rotten wir HIV aus“, einfach gesagt. Wobei hier natürlich ´ne Menge vergessen wird. Natürlich ist es problematisch, Medikamente zu verabreichen und nicht auf die medizinische Situation des einzelnen einzugehen.
Falk: Es geht wieder darum, ein guter Positiver zu sein: Einer, der in diesem System funktioniert und seine Tabletten nimmt und dadurch auch einen Mehrwert produziert. Hit hard and early, oder eben nicht, das ist eine medizinische Diskussion, die seit den Neunzigern durch die Pharmaindustrie sehr stark gelenkt worden ist. Ich hab das nicht als Moden erlebt, sondern als widerstreitende Meinungen. Deshalb waren Konferenzen immer wichtig, auch wenn ich wenig verstanden habe, außer: dass hier offensichtlich Meinung gegen Meinung steht und ich mir mein eigenes Bild machen muss. Eine Vorgabe, wann gesellschaftlich erwünscht ist, Tabletten einzunehmen, ist Therapiepolitik und schränkt meine Freiheitsrechte ein.
Stefan: Es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Das ist sehr aktuell, weil viele Präventionsstrategien eben auf die Medikamentierung zielen und andere darauf, dass man möglichst viele Menschen durchtesten will. Und es schwingt ein Vorwurf mit, wenn man sich nicht testen lassen will, weil man eine Gefahr darstellen könnte.
Dorothée: Eine Freundin von mir ist während ihrer Schwangerschaft auch ungefragt getestet worden.
Stefan: Ja. Gerade schwangere Frauen kommen in diesen Rechtfertigungszwang.
Falk: In den 1990ern gab´s in der Community eine ganz klare Forderung nach einem Recht auf Selbstbestimmung, was den Test angeht. Und das verändert sich gerade. Das ist eine Folge der wachsenden Deutungshoheit der Medizin über das Phänomen HIV. Es geht weiter weg vom Psychosozialen, hin zur Medizin. Mein Entscheidungsspielraum schwindet, dagegen muss man kämpfen.
Dorothée: Inwieweit wirkt sich die Diagnose auf die Identitätsbildung aus?
Stefan: Ich finde die Frage schwierig, weil das immer impliziert, was gewesen wäre, wenn ich mich nicht infiziert hätte.
Falk: Es wird dir auf jeden Fall ein Angebot gemacht, einen bestimmten Platz einzunehmen. Selbstbestimmung war für mich immer ein Kampf, den Kopf über Wasser zu halten und umstellt zu sein von Identitätsangeboten, die ein Versprechen machen, das sie nicht halten können. Also, für mich war es ein Prozess zu merken, dass dieses In-einem-Wir-aufgehen nicht funktionieren kann. Ich muss eine Person werden und HIV gehört dazu. Ich muss versuchen, aus dem Ausnahmezustand einen Alltag zu machen mit allen Aspekten des Lebens. Von Existenz aufbauen bis hin zu Erfüllung im Sex, Lust zurück zu gewinnen. Ich hab das in der schwulen Szene nicht immer einfach gefunden, was es an Angeboten von Wir und Community gab. Das ist mir immer ferner geworden. Ich hab versucht, auf den CSD zu gehen und das war anfangs lustig, aber eben nicht erfüllend. Jetzt ist es einfach auf der anderen Seite. Queer war für mich dann ein Ausweg.
Stefan: Inwiefern?
Falk: Ich hab mich dann in der Technoszene bewegt und irgendwann den Schritt gemacht, selbst queere Parties zu organisieren, mich mehr für Musik zu interessieren. Das hat mir Kraft gegeben – auch genommen, aber es hat mich weitergebracht.
Stefan: Jetzt hast du relativ viel aufgezählt, was für dich nicht ging. Kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich bin über Aids-Hilfe-Arbeit und andere Sachen involviert in die schwule Szene, aber ich hab auch meine Punkte, wo ich merke, dass es für mich nicht passt und auch nicht weitergeht.
Falk: Für mich passte es mehr in einer sich politisch verstehenden Szene, die andere Fragen gestellt hat und ich mit meiner HIV-Geschichte eher einen Ort hatte. Der andere Bereich war Techno, wo das auf einmal gar keine Rolle mehr spielte, woher ich komme und mich viel selbstverständlicher darüber unterhalten konnte, dass ich positiv bin und wie es mir damit geht. Und ich hab‘ Leute getroffen, die sich dafür interessiert haben.
Ich hab´s dagegen als schizophren empfunden, mich in einer schwulen Szene zu bewegen, wo HIV ein Riesenthema war und nach außen Solidarität mit Positiven dargestellt wurde und real in der Gay-Disko schlechte Erfahrungen damit zu machen. Zu erleben, wie Leute sich plötzlich nicht mehr mit mir unterhalten wollen, wenn sie mitkriegen, dass ich positiv bin oder eine andere Meinung zu Safer Sex habe.
Stefan: Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber es gibt ja nicht nur die schwule Szene. Und zwischen schwuler und queerer und Techno-Szene gibt´s ja auch Berührungspunkte.
Falk: Ausgangspunkt war ja, wie man sein Selbst bildet und das bilde ich eben nicht alleine. Das mache ich mit anderen zusammen und bei mir war es so, dass ich es dort in der schwulen Szene nicht richtig machen konnte. Und ich würde auch Aids-Hilfe als Teil dieser schwulen Szene bezeichnen. Wenn ich mich da als Positiver bewege, muss ich mich auch immer wieder damit auseinandersetzen, zum HIVchen gemacht zu werden.
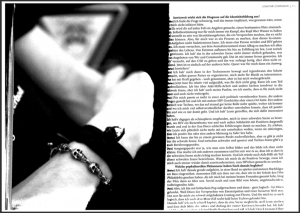
Dorothée: Welche popkulturellen Phänomene haben euch damals begleitet?
Stefan: Ich hab damals gerade aufgehört, in einer Band zu spielen und meinen Nachfolger am Bass eingewöhnt. Ansonsten fällt mir dazu nur ein, dass wir in der Schule den Film Philadelphia gesehen haben. Als ich mich bei meinen besten Freunden geoutet habe, hing der Film dann so über uns. Soviel noch mal zum Bild vom bösen, angstmachenden, todbringenden Aids.
Falk: Also, ich bin mit britischem Pop aufgewachsen und dann – ganz logisch – bei Disko gelandet. Weil Disko das Versprechen von Emanzipation und einer besseren Welt war. Das war für mich ein schwul aufgeladenes Coming-Out-Thema. Und für mich ist es auch logisch, dass ich nach dem Mauerfall recht bald beim Techno gelandet bin.
Damals hab ich auch schnell kapiert, dass da eine Szene wegbricht, weil Leute sterben und dass Aids Mitte der 1980er und Anfang der 1990er Karrieren beendet hat. Ich hab‘ viel Klaus Nomi gehört, ich fand Keith Haring kurz mal toll, ich hab Derek Jarmans Filme geliebt und das ist etwas, was heute noch eine Rolle spielt. Das ist sozusagen meine Geschichte. Und es gibt auch späte Wiederentdeckungen wie z. B. Patrick Cowley aus San Francisco, der tolle Dance Tracks gemacht hat, und erst jetzt realisiere ich, dass auch er an HIV gestorben ist. Oder die Welt von Arthur Russell. Das ist auch toll, das da was bleibt.
Dorothée: Ok, lasst uns doch erstmal eine Zigarette rauchen.
Falk: Für mich ist erstaunlich, jetzt beim Sprechen zu erleben, wie fern das alles ist: Infektion, Diagnose, positives Coming Out. Das ist so lange her und das ist Teil meines Emanzipationsprozesses, dass das so weit zurück liegt und nicht mehr so viel Macht hat. Ich bin heute ganz woanders; es sind so viele wichtige Sachen in meinem Leben passiert. Ich bin geprägt von den Bildern vom alten Aids und da ist immer noch ganz viel Drama. Aber viele Sackgassen sind real. Ohne sie sähe mein Leben anders aus: z.B. plane ich nicht länger als ein halbes Jahr, weil das irgendwann mal erzwungenermaßen so war. Mittlerweile merke ich, dass ich weiter ganz gut damit fahre, im Moment zu leben.
Dorothée: Gibt es beim neuen Aids überhaupt noch so etwas wie eine Überlebensstrategie?
Stefan: Wie hieß das Motto vom SÖDAK, dem Deutsch-Schweiz-Österreichischen AIDS-Kongress von vor zwei Jahren nochmal? Prepare for the long run. Für die meisten wird es möglich sein, relativ lange zu leben: Es geht jetzt eher um die Bewältigung des Lebens mit allen möglichen anderen Problemen. HIV ist ein Cluster und die meisten HIV-Positiven haben noch ganz andere Probleme. Das war in den 1980er/1990er Jahren anders. Da stand die Behandlung der Infektion und ihrer Begleiterscheinungen im Vordergrund. Die Leute können heute entscheiden, wie sie ihr Leben mit HIV gestalten wollen.
Falk: Es ist ein Resultat medizinischer Behandelbarkeit dank Kombitherapie, dass das Drama raus ist. Es wird noch gestorben, aber nicht mehr so oft. Die Leute sind noch krank, aber nicht mehr so schwer. Wenn viel jüngere Leute heute ihr Testergebnis kriegen, haben sie eine ganz andere Selbstverständlichkeit damit. Sie profitieren von zuvor erkämpften Errungenschaften. Das ist toll. Und davon profitiere ich auch, das gibt mir Kraft.
Stefan: Das Sterben ist heute leiser. Es wurde früher — auch zur Abschreckung — anders inszeniert. Die Positiven, die heute in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, sind die, die gesund sind und ein normales Leben führen. Denen es nicht gut geht, die siehst du nicht.
Falk: Es gibt heute mehr Leute, die sich raustrauen. Aber ich nehme trotzdem wahr, dass es nicht für alle selbstverständlich ist.
Dorothée: Wie ist eure Erfahrung, euch als positiv zu outen?
Falk: Die allergrößte Rolle spielt es dann, wenn man mit jemandem Sex haben will. Da ist dann erstmal ganz viel Kopfkino bei mir selbst. Da ist aber auch eine reelle Chance, Ablehnung zu erfahren. Das ist selten, aber das passiert: Dass irgendein Typ mit mir rumknutschen will und – sobald das Thema HIV auf dem Tisch ist – plötzlich nicht mehr will. Das verletzt sehr und ist hart. Es ist nur gut und richtig, solche Situationen abzubrechen und mir selbst zu sagen: „Ich nehm‘ das jetzt nicht an.“ Das ist ein Problem, dass diese Person mit sich selbst hat. Vielleicht ist es auch besser zu sagen: „Ich kann das jetzt nicht.“ Das ist jedenfalls besser, als sich aus dem Staube zu machen und ich weiß dann nicht, warum eigentlich.
Das alles hat auch zur Folge, dass – obwohl ich es gerne klar hätte – es Situationen gibt, in denen ich mein Positivsein besser nicht offenlege. Das ist nicht super.
Dorothée: Und bezogen auf Sex?
Falk: Was eine Rolle spielt, ist die derzeitige gesellschaftliche Diskussion um Strafverfolgung. Da geht es um Fälle, die vor Gericht verhandelt und in denen Leute verurteilt werden, weil sie ihren Immunstatus vorm Sex nicht bekanntgegeben haben. Oder es wurden Leute verurteilt, die Safer Sex praktiziert haben, es also keine Risikosituation gab. Das wird momentan alles noch mal etwas unklarer, da durch die Behandlung die Infektionswahrscheinlichkeit nicht höher ist als beim Gebrauch eines Kondoms. Da ist sehr viel Unklarheit, die ich sozusagen in mein Leben, mein Handeln sofort einbauen muss: Diskussionen, die auf meinem Rücken ausgetragen werden. Ich seh’ das als eine Zuweisung, dass ich als Positiver die Verantwortung übernehmen soll, und zwar komplett. Das ist stark belastend und kostet Energie. Das kann ich nicht machen.
Serosorting – Sexpartner nach dem gleichen HIV-Status auszusuchen, um Übertragungsrisiken zu minimieren – ist da eine mögliche Lösung. Gerade in den Metropolen — und übers Internet sowieso – funktioniert es mühelos, Sexpartner mit gleichem Immunstatus auszusuchen.
Dorothée: Ok, das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass das ein Freifahrschein für Sex ohne Kondom zwischen zwei vermeintlich HIV-Negativen ist.
Falk: Genau.
Stefan: Das Problem bei Serosorting ist, dass gerade andere Geschlechtskrankheiten weiter gegeben werden: Syphilis, Tripper, Chlamydien. Es gibt zudem viele Hepatitis-C-Co-Infektionen, mit denen man sich keinen Gefallen tut. Die Übertragungswege sind noch nicht ganz klar. Beispielsweise haben in Amsterdam ca. 25% der HIV-positiven Männer eine Co-Infektion mit Hepatitis-C. Das erschwert die Behandelbarkeit.
Falk: Ich hab jedenfalls gute Erfahrungen damit, zu verhandeln, was genau jetzt abläuft. Sex ohne Kondom ist nicht zwangsläufig unsafer Sex. Das kann verantwortungsbewusst sein, das können sehr ehrliche, nahe Momente sein.
Stefan: Da geht´s um Kommunikation und Vertrauen.
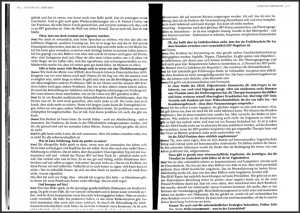
Dorothée: In einer Studie der EKAF, Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen in der Schweiz, von 2008 wird folgendes gesagt: „Wer seit mindestens 6 Monaten eine Viruslast unter der Nachweisgrenze hat, die Therapie konsequent durchführt und keine weiteren sexuell übertragbare Krankheiten hat, überträgt HIV beim Verzicht aufs Kondom mit einer Wahrscheinlichkeit, die der von Safer Sex – bei Kondomengebrauch – ohne diese Voraussetzungen entspricht.“
Stefan: Ich bin schon Leuten begegnet, die glaubten negativ zu sein und meinten: „Gut, ich geh davon aus, dass ich mich bei dir nicht infizieren kann. Wir können das Kondom weglassen.“ Das ist dann trotzdem kein unsafer Sex. Man versucht, das Risiko zu minimieren. Was anderes ist die Kondomnutzung auch nicht. Im Gegensatz zu Safer Sex gibt es Safe Sex einfach nicht, weil man nie 100% Sicherheit hat. So ist ja schon vor der EKAF-Studie nicht nur in schwulen Kreisen praktiziert worden, auf das Kondom zu verzichten, wenn der HIV-Positive Sexpartner eine gut eingestellte Therapie hatte und das Virus im Bluttest praktisch nichtmehr nachweisbar war.
Dorothée: Ist die EKAF-Position denn wirklich angekommen?
Stefan: Tja, man muss sagen, dass sie sich damals auf heterosexuellen Vaginalverkehr bezog und erstmal nicht auf homosexuellem Analverkehr. Da fehlten einfach die Daten. In den schwulen Subszenen wurde die Studie aber als Bestätigung für etwas, was man schon praktiziert hat, aufgenommen.
Dorothée: Dazu gibt es gerade neue wissenschaftliche Ergebnisse, die bestätigen, das die Viruslast im Analsekret nicht höher ist als im Vaginalsekret.
Falk: Das ist alles unheimlich schwer zu kommunizieren und kompliziert. Gerade auch im Freundeskreis. Das hat mit den alten Bildern von Aids zu tun. Aber mich persönlich entlastet diese EKAF-Geschichte ungemein. Das ist Normalisierung im besten Sinne. Gleichzeitig merke ich, dass von den alten Bildern nicht losgelassen werden will.
Das EKAF-Papier hat natürlich Auswirkungen auf mein Privatleben. Wie gehe ich in meiner diskordanten Beziehung (einer ist positiv, einer negativ) damit um, in der mein Freund Probleme damit hat, dass ich zwar selten, aber manchmal eben doch Bareback-Sex mache, obwohl wir miteinander immer Gummis benutzen. Ich merke, dass es hier Grenzen der Verständigung gibt. Mein Risikomanagement ist nicht seins und momentan haben wir darüber eine Diskussion. Bis das geklärt ist, werde ich auf verhandelten Sex ohne Kondom vorerst verzichten. Es muss sich erst noch herausstellen, ob dass in unserer festen Beziehung funktionieren kann.
Dorothée: Kannst du nochmal die unterschiedlichen Strategien beleuchten. Früher Safer Sex, heute Risikomanagement — was ist der Unterschied?
Stefan: Man geht heute nicht mehr davon aus, dass jemand immer zu 100% safe agieren kann und macht den Leuten bewusst, in welcher Situation ein besonders hohes und in welcher ein eher geringes Risiko vorliegt. Dann sollen die Leute selbst entscheiden. Natürlich gibt es Fehlinformationen z.B. die Ansicht, dass, wenn ich aktiv bin, mir nichts passieren kann. In der jeweiligen Situation ein rationales Urteil zu fällen und alle Faktoren mit einzubeziehen, ist nicht ganz einfach. In einer diskordanten Partnerschaft kann man das natürlich besser verhandeln und Situationen durchspielen.
Falk: Was mich in diesem Moment interessiert, Stefan, ist, wie sich das EKAF-Papier auf deinen Job als Pornodarsteller auswirkt?
Stefan: Also, die Pornos, in denen ich mitspiele, unterliegen strengsten Safer-Sex-Prinzipien. Also, nie Abspritzen im Mund und Ficken immer mit Kondom. Ich hab da bis jetzt auch immer Wert drauf gelegt. Im Schwulenbereich sind die meisten eh mit Kondom im Gegensatz zu Heteropornos. Ich find’s nicht gut, wenn Filme als „komplett gummifrei“ angepriesen werden. Das hat nichts mit Normalisierung zu tun. Was ich cool finde, sind Filme, in denen mit und ohne Gummi gevögelt wird. Das bildet das reale Leben am besten ab und ich glaube, dass es eher zur Reflexion beiträgt.
Dorothée: HIV wird als Krankheit gesehen, die gut behandelbar ist. Man spricht von einer Lebenserwartung, die ungefähr so hoch wie bei Diabetes ist. Wie sieht das Überleben mit HIV heute aus?
Stefan: Naja, es sterben genug Leute auf der Welt an Aids. Wenn man positiv ist, kann man froh sein, als Schwuler in einem westlichem Land zu leben.
Falk: Überleben heißt für mich auszuhalten, dass es nicht überall auf der Welt so ist. Das erlebe ich als Wahnsinn, dass nicht alle Menschen in den Genuss medizinischer Behandlung kommen.
Ich danke Falk und Stefan für ihre Offenheit.
Dorothée, 36: arbeitete vor 15 Jahren bei der Aids-Hilfe Nürnberg. Seither befasst sie sich mit queerer Sexualität und neuen gesellschaftlichen Bildern von Aids. „Immer rein damit“ nannte sie einen ihrer Workshops zu HIV in Zeiten der Therapierbarkeit. Die diplomierte Pädagogin hat die Jobs im Sozialbereich jedoch vorerst an den Nagel gehängt. Die Arbeit in der Aids-Prävention hat auch dazu geführt, dass sie heute übergroße Perlen-Halsketten aus schwarzen Latexkugeln produziert: „Das soll Kunst sein?“, überlegt sie und beschäftigt sich sonst mit Materialien und Oberflächen, was demnächst in einem entsprechenden Studium vertieft werden könnte. In der Testcard #17 zum Thema Sex hat Dorothée bereits einen Beitrag zu BDSM veröffentlicht.
Stefan, 32: Wer in Stefans Wohnung kommt, stolpert über unendlich viele Paare Sneakers. Wenn Stefan durch Berlin läuft, dann auf einem Marathon. Seit elf Jahren wohnt er hier, hat gerade sein Studium in Germanistik, Politik und Geschichte abgeschlossen und nebenher Präventionsarbeit mit Jugendlichen gemacht. Beim Gay Switchboard „Mann-O-Meter“ ist er frisch als psychologischer Berater und Jugendgruppenleiter angestellt. Für andere ist es nicht so einfach, seinen Job als Porno-Darsteller mit seinem Beruf zu vereinbaren. Für Stefan muss das irgendwie gehen. Genauso, wie ein Leben zwischen hier und Süddeutschland, wo sein Freund wohnt.
Falk, 38: schreibt automatisch ein Plus hinter seinen Namen, Falk+: „Das kann ich mir nicht mehr abgewöhnen“. Er ist an der Ostsee aufgewachsen und war der erste Zivi der rostocker Aids-Hilfe. Später lebte Falk lange in Leipzig, baute dort das queere Party-Kollektiv Homo Elektrik mit auf („Tanzen ist die wärmste Jacke“) und arbeitete mehrere Jahre bei den Drug Scouts, einem akzeptierend arbeitenden Drogen-Info-Projekt.
Für den berliner Club ://about blank macht er derzeit Grafik und hangelt sich ansonsten von Projekt zu Projekt. Mit einem Freund betreibt er zwischen Berlin und Leipzig das Techno-House-Label Mikrodisko. Falk hält sich momentan wahrscheinlich in Paris oder Kalifornien auf und isst gerne Schokolade.
Die Fotos stammen aus der Serie „Punk Skin“ von 2009. Titelbild und Faksimiles hat Jérémy Geeraert produziert. Danke alle Beteiligten für die Gestattung des Abdrucks.
testcard, eine Anthologie zur Popgeschichte und -theorie in deutscher Sprache, erscheint ein- bis zweimal im Jahr (Broschur, je ca. 300 Seiten mit zahlreichen Abbildungen). Artikel zu Musik, Film und zeitgenössischer Kunst kreisen in jeder Ausgabe um einen wechselnden Themenschwerpunkt.
Abo und bestellen
www.testcard.de/abo
testcard #21
www.testcard.de/titel/1368/testcard-21-ueberleben-pop-und-antipop-in-zeiten-des-weniger
